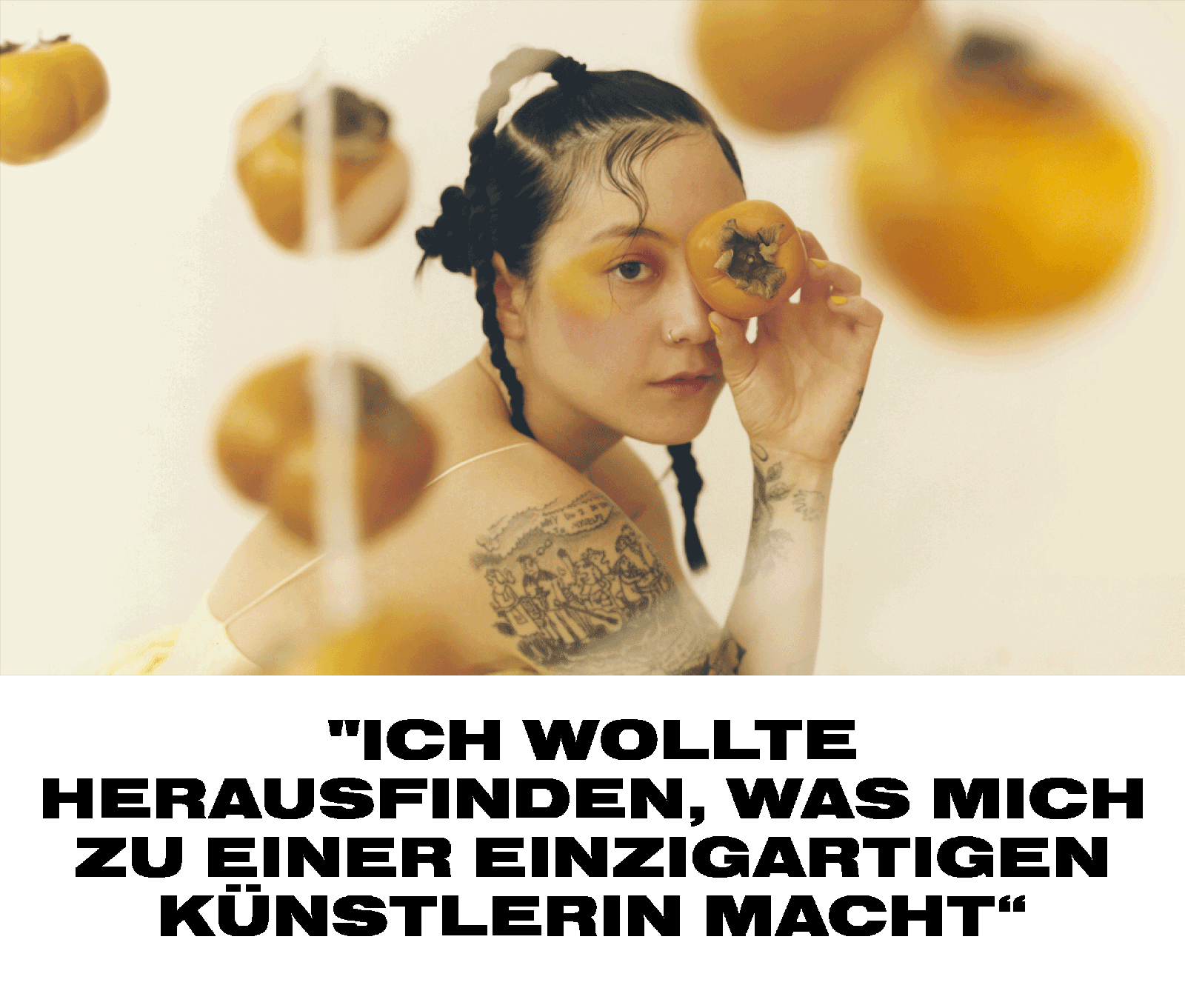Nach etlichen Verschiebungen von Tour und Album, ist endlich die neue Platte „Wild Haired“ von Telquist raus. Warum die Veröffentlichung auch eine Art Befreiungsschlag für den Musiker ist, welche Gedanken ihn bei seinen Songs getrieben haben und was er von Selbstdarstellung und das Stehen in der Öffentlichkeit hält, hat er uns im Interview verraten.
Sebastian Eggerbauer hat als Jugendlicher Bass in Indie, Reggae und Ska-Punk Bands gespielt. Dann merkte er, dass er eigentlich lieber allein Musik machen will – das Ergebnis davon: Telquist – lässiger Indie-Pop mit elektronischen Sounds und einer Portion Reggae. Letzte Woche veröffentlichte er mit „Wild Haired“ sein zweites Album. veröffentlicht. Bei den Live-Auftritten unterstützt ihn seine Band, wozu Max Gerisch, Christoph Hundhammer und Thomas Huck gehören. Gerade auf der Bühne haben sie für ihn einen besonders hohen Stellenwert für das Musikprojekt hat.
Sebastian aka Telquist macht sich um vieles Gedanken, was er in seiner Musik auf eine Art und Weise übersetzt, die zwischen Melancholie und Euphorie hin und her schaukelt. Er sorgt gleichzeitig für Summervibes und macht Bock auf Tanzen, kann aber genauso zum Nachdenken und Träumen einladen. Einerseits wehmütig und auf der anderen Seite berauschend. Der Titel seines Songs „High and Low“ beschreibt es wohl ganz gut. Im Interview erzählt Selbastian mehr über sich, sein neues Album „Wild Haired“ und welche Gedanken ihn traurig machen.
Du hast ja schon bevor du überhaupt auf die Idee gekommen bist zu singen, Musik gemacht. Wie hat sich Musikmachen für dich insgesamt verändert?
Für mich war es, wie das Projekt überhaupt erst entstanden ist, ein wichtiger Schritt, dass ich wirklich allein angefangen habe, Musik zu machen. Als Teenie haben wir in den Bands, in denen ich war, einfach immer versucht zusammen Mukke zu machen. Da war dann der entscheidende Moment, dass ich mit einem Laptop theoretisch alles selbst machen kann. Du bist halt so frei und kannst alles machen, worauf du Bock hast.
Wenn ich will, kann ich morgen einen Track machen, der so klingt wie Scooter oder so. Ich kann an einem Tag auch mal keinen Bock haben Musik zu machen – das ist schon was anderes als Band. Ich finde, das ist das Faszinierende daran. Du musst halt niemanden fragen. Als Band muss man sich immer aufeinander einlassen – und klar, man kann andere coole Sachen produzieren, aber ich habe einfach einen unmittelbareren Draht zur Musik, wenn ich es allein machen kann.
Versuchst du denn beim Produzieren auch schon darauf einzugehen, was andere jetzt hören wollen, um den Geschmack der Hörer:innen zu treffen?
Manchmal mache ich Dinge schon so, wie andere es gut finden könnten, das ist mir bewusst. Da kann ich aber auch immer ein bisschen entgegensteuern, indem ich mir immer vor Augen führe, dass es nur mir selbst gefallen muss. Ich finde darum geht es auch, warum man Musik machen sollte – aus Liebe zur Musik und dass der einzige Maßstab, den man hat, der eigene Geschmack ist.
Deine neue Platte „Wild Haired“ klingt ja schon anders als dein Debüt „Strawberry Fields“. Was ist seitdem musikalisch oder persönlich nochmal anders für dich geworden?
Die krasseste Veränderung war, dass ich die erste Platte nicht für eine Öffentlichkeit gemacht habe. Ich mag das erste Album, aber wenn ich mir das anhöre, denke ich mir jetzt schon so: Fuck, das hätte ich niemals so geschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass es auch ein Publikum dafür gibt. Ich hatte ja damit angefangen, weil ich Lust hatte, Musik zu machen. Die Songs lagen lange bei mir rum, ohne darüber nachzudenken, die veröffentlichen zu wollen.
Verspürst du jetzt mehr Druck mit dem Wissen, dass das andere hören?
Das ist schon etwas anderes, wenn ich jetzt weiß, dass es eine kleine Form von Öffentlichkeit gibt, die sich dafür interessiert, sich das anhört und mich dazu vielleicht etwas fragt. Alle sagen immer, dass die aktuelle Platte die persönlichste Platte ist, die sie jemals gemacht haben. Ich glaube, bei mir ist es jetzt nicht so, weil ich ein bisschen vorsichtiger geworden bin.
Es ist natürlich trotzdem persönlich und man kann ja sowieso immer nur das machen, was man fühlt und erlebt. Andererseits wollte ich bei „Wild Haired“, dass es mehr knallt. Das hatte die erste Platte auch gar nicht, weil es mir da auch nicht wichtig war. Ich fand eben diese moody chillige Musik nice und weil das ja eh niemand hören sollte, gab es überhaupt nicht den Gedanken an ein Album als Ganzes.
Du hast gesagt, dass man Musik aus Liebe dazu machen sollte. Wie sehr trifft es dich, wenn du negative Kritik bekommst?
Also ich versuche mir immer einzureden, dass mir das egal ist und dass ich es ja eh für mich selbst mache – aber im Endeffekt trifft mich das schon immer, wenn jemand sagt, er findet das scheiße. Zu der ersten Platte gab es schon so paar Kritiken, die jetzt nicht voll bombastisch waren. Da denkt man schon drüber nach. Wenn ich behaupten würde, dass ich da vollkommen drüberstehe, wäre das gelogen.

Ich nehme dich als jemanden wahr, der sich sehr viele Gedanken macht und sich und das, was in seiner Umgebung passiert, reflektiert. Nicht nur auf deine Texte bezogen, sondern auch, dass du ganz genau weißt, was du willst und von deiner Musik oder deinem Sound erwartest. Ist dem so?
Ja, das ist schon so. Ich glaube, das hat viel mit der Geschichte zu tun, wie das mit dem Musikmachen entstanden ist. Das war ja nicht unbedingt mein Plan und irgendwie ist halt alles so passiert, indem ich die Möglichkeit bekommen habe, meine Musik zu veröffentlichen. Auf einmal wird man dann als Musiker wahrgenommen und steht in der Öffentlichkeit. Das war jetzt nichts, was ich angestrebt habe oder auch ausschließlich angenehm ist.
Also, es ist schon schön, aber ich bin in die Situation so ein bisschen reingestürzt. Ich glaube, das kommt ganz automatisch, dass man das immer ein bisschen hinterfragt und darüber nachdenkt, ob das eigentlich das richtige ist und das, was ich überhaupt will. Wenn ich jetzt zwangsläufig meine Zeit und Energie da rein investiere, was ja auch logisch und gut und schön ist, frage ich mich natürlich auch, was das jetzt mit mir macht und ob das alles Sinn macht. Das begleitet mich täglich, aber ich glaube nicht, dass nur ich diese Gedanken habe.
Wie war das beim neuen Album für dich, welche Themen hatten hier einen großen Einfluss?
Im Grunde ist es tatsächlich das, was ich eben schon ein wenig gesagt habe. Darum geht es auch im Titeltrack ein bisschen und schwingt in allen anderen Songs auch mit. Das ist so die Frage, wie kann ich das als jemand, der sich jetzt berufsbedingt quasi andauernd darstellen und produzieren muss, für mich lösen? Das ist etwas, das dazu gehört, ob man es mag oder nicht.
Ist diese Art von Selbstdarstellung ein Problem für dich?
Wenn ich durch mein Instafeed scrolle, macht mich das ein bisschen traurig. Ich gehöre ja auch irgendwie in diesen Indie-Kosmos und da ist mir aufgefallen, dass alle das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie besonders machen: Jeder muss crazy ausschauen, jeder muss etwas Verrücktes sagen, um sich irgendwie oder irgendwas darzustellen. Ich verstehe das total und kann das nachvollziehen.
Es ist logisch und ich finde es auch voll okay, aber es macht mich auch eben traurig, weil ich mir mehr wünschen würde… man ist doch so ok, wie man ist. Jeder darf etwas Besonderes sein, aber niemand muss etwas Besonderes darstellen. Diese Frage steht da so ein bisschen hinter. Ich denke, dass das etwas mit unserer Zeit und Social Media zu tun hat. Jeder ist sozusagen ein halber Freelancer und muss sich verkaufen. Ich will das nicht kritisieren, aber das sind Dinge, die mich beschäftigen und die mir teilweise echt schwerfallen und eine Rolle für mich spielen.
Dein neues Album „Wild Haired“ hat auch einen gleichnamigen Song auf der Platte – was bedeutet dieser Titel für dich?
Das ist eigentlich ein Zitat aus einem Jack Kerouac Roman aus den 50er/60ern in Amerika. Er beschreibt da einen Moment von Glückseligkeit, weil er sich die Freiheit nimmt außerhalb der Gesellschaft zu stehen. Dazu kommen noch andere Dinge, wo er überall anecken würde, wenn er da jetzt Wert drauflegen würde, wie eine wilde Frise und sowas.
Das fand ich schön und es ist einerseits natürlich Kitsch und überholt, aber gleichzeitig finde ich es auch aktuell. Wenn du heute eine verrückte Frisur trägst, ist das beispielsweise schon eher an der Tagesordnung. Ich habe das Gefühl, genau das steckt dahinter – diese Begriffsgeschichte, die sich in die vielleicht schon fast Groteske verschoben hat, weil man gleichzeitig anders sein möchte und sich abgrenzen will. Das hat mich zu diesem Song und Albumtitel inspiriert. Das ist so eine Thematik, die mir für das Album wichtig war.
Deine Musik wird auch oft mit Melancholie und Euphorie in Zusammenhang gebracht. Was ist Melancholie für dich und welche Rolle spielt das für deine Kreativität?
Ich habe eigentlich schon immer eher traurige Musik gehört. Als ich so 13, 14, 15 Jahre alt war, habe ich angefangen richtig viel Musik zu hören. Da habe ich dann einen richtigen Draht zur Musik entwickelt. Das war bei mir so eine Zeit, in der ich viel allein war. Nicht im Sinne, dass ich keine Freunde hatte, sondern, dass Bezugspersonen, die man früher hatte, verloren gingen. Diese Zeit ist ja auch generell für viele Leute eine schwierige Phase. Da war Musik ein wahnsinniger Anker für mich. Traurige melancholische Musik hat mir dabei geholfen und diesen Draht habe ich immer noch. Ich liebe es so wehleidige und traurige Musik zu hören.
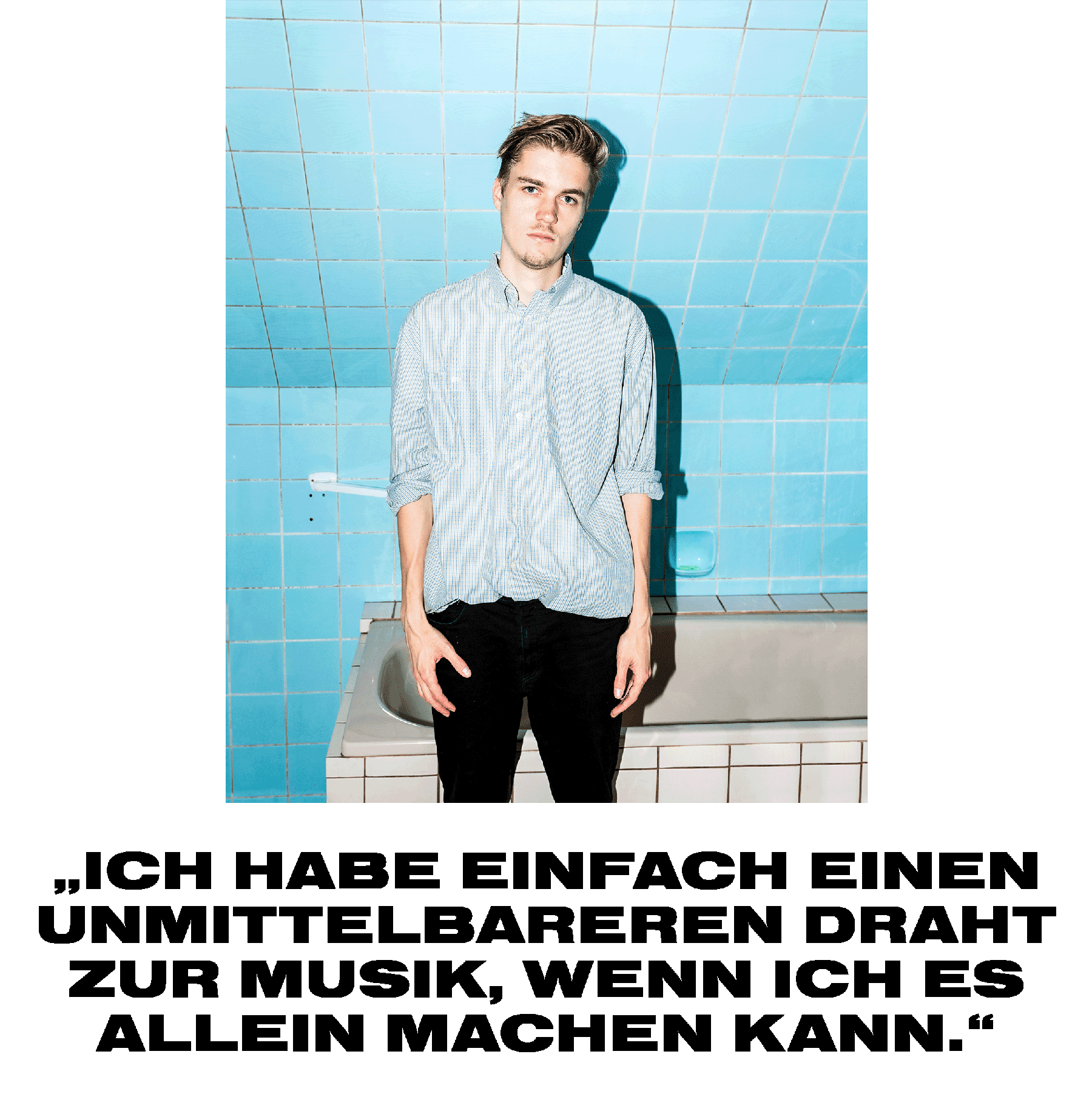
Jetzt ist „Wild Haired“ eigentlich schon eine ganze Weile fertig und sollte ursprünglich viel früher veröffentlicht werden. Ich stell‘ mir das ganz schön ätzend vor, so lange auf den Release zu warten. Wie war das für dich?
Ja, das war tatsächlich ziemlich ätzend, weil ich die Platte sozusagen „in einem“ gemacht habe und wie du sagst, es hat jetzt wirklich ewig lang gedauert. Ende 2019 ist mit „Trash Talk“ der erste Song rausgekommen, das sind jetzt 1,5 Jahre … Es ist sehr schwierig, weil man neue Dinge tun will und man das ja schon machen kann, aber irgendwie steckt man immer noch so in der alten Platte. Man muss die nach außen ja auch immer vertreten. Deshalb bin ich jetzt mega mega froh, wenn „Wild Haired“ einfach raus ist – einfach deshalb, weil dann auch ein Kapitel abgeschlossen ist.
Unabhängig davon sind viele Songs eigentlich „gar nicht so neu“ für dich, die schleppst du ja teilweise schon lange mit dir rum. Haben sich diese Songs dadurch in der Entstehung zu „Wild Haired“ nochmal verändert?
Das ist voll unterschiedlich, zum Teil tendenziell schon. Der Grund ist ja oft, wenn man etwas liegen lässt – bei mir jedenfalls – dass man nicht mehr so richtig weiterweiß. Das Schöne daran ist oft, dass wenn ich das Projekt auf meinem Computer wieder aufmache, dann hört man das wieder ganz anders und hat andere Ideen und kann es fertigmachen. So habe ich schon immer gearbeitet.
Also ich habe ganz viele Songs, die so halb fertig auf meiner Festplatte schlummern. Von Zeit zu Zeit klicke ich mich immer mal durch und da ist dann immer was dabei, was mich so auf eine andere Art anfixt, wie ich es ursprünglich gedacht habe. „Mojo“ kam beispielsweise letzten November rausund ist eigentlich schon wahnsinnig alt und lag ewig rum. Der Beat ist einer der erste Sachen, die ich überhaupt selbst gemacht habe. Der Song hat vorher aus den verschiedensten Gründen einfach nicht auf die erste Platte gepasst. Jetzt läuft die Single mit Abstand am besten.
Vor dem Album-Release hast du jetzt noch die Single „Am I Right“ herausgebracht. Was steckt hinter dem Song?
Der Song ist die erste Single, bei der ich mir gar nichts ausgerechnet habe, weil es eigentlich vom Format her keine Single ist. Sie ist zu ruhig, hat jetzt auch nicht so eine richtige Hook oder so. Ich mag traurige Musik ja ganz gerne. Deshalb muss ich gleichzeitig auch dazu sagen, dass es einer meiner Lieblingssongs auf der Platte ist. Das war dann auch so ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit zu sagen: Hey scheiß drauf, wir haben mit „Mojo“ jetzt eine Single, die gut für das Album läuft und wenn wir jetzt noch einen Song davor pushen … dann halt den, den ich gerne mag.
Der wird jetzt nicht im Radio rauf und runter gespielt und wird wahrscheinlich auch kein Streaming-Hit werden. Aber ich glaube fest daran, dass er trotzdem seine Hörer:innen finden wird, wenn er seine Chance kriegt. Das war einfach schön so. „Am I Right“ ist jetzt noch nicht lange raus, aber ich habe sehr viel Feedback gekriegt, dass die Leute berührt sind. Das ist echt toll und das Schönste ist, wenn man das, was man selbst fühlt, weitergeben kann.
Warum bedeutet dir der Song so viel?
Ich mag den Song schon gern, weil er für mich von Anfang an beschrieben hat, dass ich als Künstler frei bin, dass ich alles machen kann – die Nummer ist ja fast so eine Trap-Nummer. Das finde ich mega, dass ich sowas raushauen kann anstatt so Nummern, die vielleicht besserlaufen als ein klassischer Indie-Song. Das bedeutet mir einfach so viel, dass ich mich hinsetzen kann und machen kann, was ich will. Das verkörpert „Am I Right“ für mich. Dazu kommt aber auch noch dieses Gefühl, welches ich hatte als ich diesen Song gemacht habe.
Was war das für ein Gefühl?
Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Worten beschreiben kann. Also, ein sehr guter Freund von mir hat sich von seiner Freundin getrennt und war dann kurze Zeit später mit einer anderen Freundin zusammen. Also alles war toll und die sind auch immer noch zusammen. Ich dachte mir dann aber so, fuck, vor drei Monaten war er noch mit jemand anderem so glücklich und seine Zukunft hat so anders ausgeschaut. Er war sich ganz sicher in allem und dann wurde alles was er sich ausgemalt hatte, mit einem Schlag so nichtig.
Es kann jederzeit passieren, dass alle Hoffnungen, Wünsche und Träume, die man jetzt hat, morgen vollkommen obsolet sein können. Dieses Wissen macht einem die Begrenztheit von der eigenen Gedankenwelt klar. Wenn ich den Song höre, berührt mich das und dann fühle ich das auch wieder. Das ist ein Gedanke, der mich sehr traurig macht. Aber ich finde auch, dass so ein trauriger Song einem ja eher hilft, als dass er einen noch runterzieht. Jedenfalls ist das bei mir als Hörer so.
Ja, ich finde auch. Man interpretiert als Hörer:in ja auch oft sein Zeugs dann rein. Mich hat auch „Cheesy Cars“ und besonders „Wild-Haired“ sehr berührt. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber der Sound löst direkt etwas in mir aus, wenn das Schlagzeug reinkickt – da bekomme ich direkt Bilder in den Kopf und werde an extreme Gefühle erinnert, die ich jetzt mal als meine „Wild Haired“-Zeit bezeichnen würde.
Ja cool, danke, das freut mich! Ich glaube, ich weiß voll, was du meinst. Das mag ich auch gerne beim Hören, wenn man den Vibe nicht so genau einordnen kann.
Ja, ich finde, da trifft es die Beschreibung zwischen Melancholie und Euphorie ganz gut – also eine schöne Art von Melancholie, die sich gut anfühlt. Das ist jetzt alles natürlich sehr persönlich, aber mich zieht der Sound direkt mit und versetzt mich in so eine besondere Stimmung.
Das überrascht mich ehrlich gesagt einerseits auch, weil ich zwar immer dachte, das Lied ist cool, aber nicht so eine Nummer, die einen in dem Sinn so catcht. Aber toll, wenn’s funktioniert, das freut mich wirklich sehr!
Ich höre so raus, dass du die Dinge schon gern selbst in die Hand nimmst und schwer abgeben kannst. Bei „Wild Haired“ hast du jetzt mit einem Produzenten zusammengearbeitet – wie war das für dich?
Ja, das ist wirklich so. Deshalb total überraschend, dass es so gut funktioniert hat. Ich glaube das hat generell ganz viel damit zu tun, dass Mario und ich uns menschlich sehr schnell, so gut verstanden haben. Da hat es dann auch musikalisch geklappt. Er hat gesehen, dass ich schon eine Idee und konkrete Vorstellung davon habe, was ich tun will und sofort gecheckt, dass es dann nicht geht, dass er dem Album irgendetwas aufdrücken will. Wir wollten eben zusammen eine coole Platte machen.
Das war wirklich eine tolle Erfahrung für mich, weil ich bis dahin immer dachte: Wäre schön mit anderen kreativ Musik zu machen, aber da bin ich leider der Falsche. Aber für „Wild Haired“ war das dann eben wirklich ein ganz entspanntes und schönes Arbeiten. Da bin ich echt froh, dass ich das mit ihm gemacht habe und dass es auch gut geworden ist.
Welcher Moment hat dich bisher in deiner Karriere am meisten geprägt?
Wir waren mal als Band mehrere Tage unterwegs und haben davor nur vereinzelt und ganz wenig gespielt. Da ist gerade alles langsam und schön angelaufen. Die erste Platte war da ungefähr ein halbes Jahr alt und dann haben wir nachmittags am letzten Tag eines kleinen Festivals in der Nähe von Regensburg gespielt. Wir dachten, weil es auch außerhalb war, dass es jetzt echt zäh wird und schon geil wäre, wenn zehn Leute da sind. Es war halt noch so früh und bei dem vor uns, waren wirklich weniger als zehn Leute da.
Auch bei uns war es nicht voll, aber im Endeffekt waren dann 50-60 Leute da und haben sich aus unserer Heimatstadt auf dem Weg gemacht. Das war das erste Mal, dass ich gecheckt habe, dass man offensichtlich Leute erreicht, die sich das anhören, weil sie es wirklich gut finden und das nicht nur etwas ist, dass sich im Internet abspielt. Das finde ich bis heute noch so den krassesten Moment, weil ich das einfach nicht auf dem Zettel hatte, zu schön war das für mich.
Wie geht es nach dem Release jetzt für dich weiter? Was fehlt dir zurzeit am meisten und worauf freust du dich?
Wie die meisten Musiker wahrscheinlich das Spielen. Wobei, ich habe mich vor ein paar Tagen mit der Band getroffen. Man sagt zwar, man vermisst es so, aber wir können uns irgendwie gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie es so war. Teilweise ist es jetzt knapp 1,5 Jahre her und klar freue ich mich. Ich bin aber auch gespannt, wie das dann ist. Das erscheint mir so unwirklich im Nachhinein. Und das andere, worauf ich mich wirklich wirklich freue, ist, neue Musik zu machen. Einfach darauf los und vielleicht auch die Chance zu haben, dass es dann bald erscheint und nicht erst drei Jahre später. Da freu ich mich drauf!