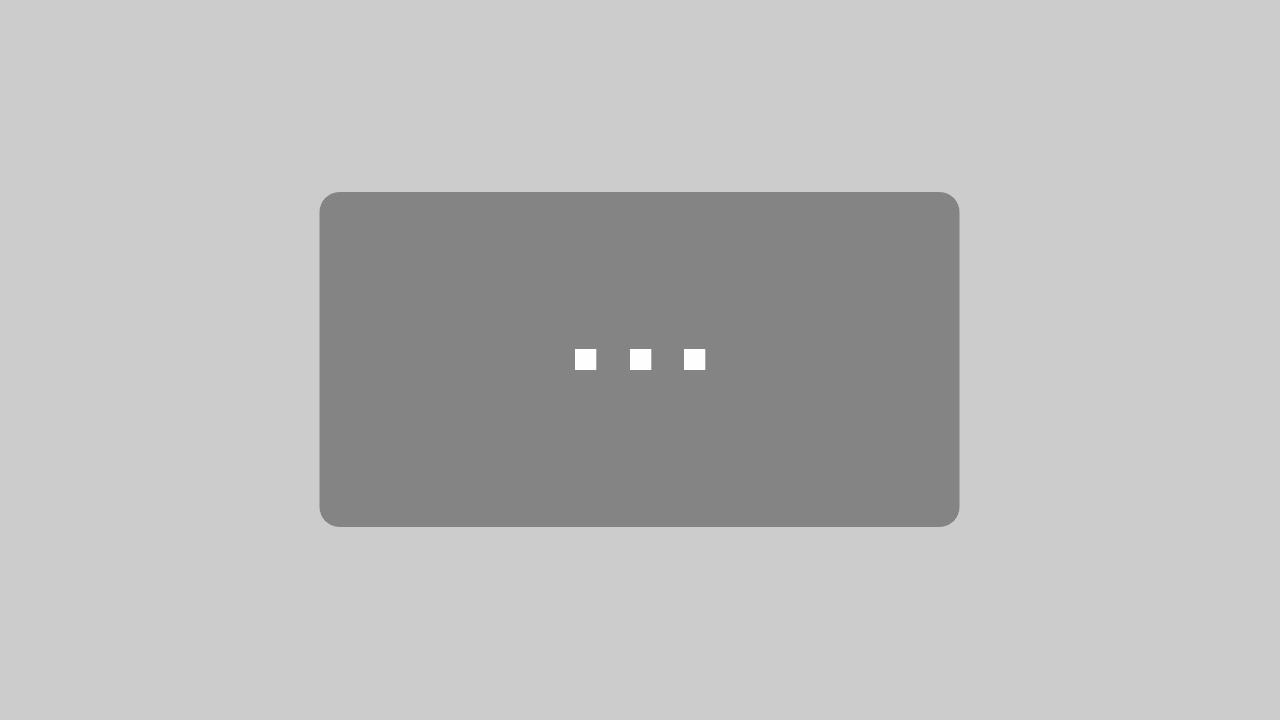Mit Gewalt, Gefühl und Transzendenz
Starke Gefühle entstehen durch Reibung. Ob an Noise und Electropunk oder an der Intimität von James Blakes Post-Dubstep-Poems, ist egal. Im Mai gab’s mal wieder was Neues von den Schelmen von Death Grips, außerdem Transzendenz durch Introspektion, Rave, kenianische Folklore und Psychedelik. Achja, und unsere Lieblings-Krautpopper von Klaus Johann Grobe sind auch mit einem Album am Start. Viel zu entdecken, also stürzt euch rein.
Death Grips: Bottomless Pit
 Zach Hill, MC Ride und Andy Morin waren immer schon extrem drauf, und trotzdem wird Bottomless Pit seinem hyperbolischen Titel gerecht. Als hätten Genre und Präfix die Plätze getauscht, fängt das fünfte Album von Death Grips mit Blastbeat und chaotischem Noisecore an – statt hardcore Hip-Hop scheint die Devise Hardcore mit Hip-Hop zu sein. Den Ohrenschmerz/-schmaus (je nach Standpunkt) von „Giving Bad People Good Ideas“ und „Hot Head“ relativieren die folgenden Songs zwar etwas, aber Bottomless Pit gehört selbst ohne die beiden ersten Knaller noch zum Brutalsten der DG-Diskographie.
Zach Hill, MC Ride und Andy Morin waren immer schon extrem drauf, und trotzdem wird Bottomless Pit seinem hyperbolischen Titel gerecht. Als hätten Genre und Präfix die Plätze getauscht, fängt das fünfte Album von Death Grips mit Blastbeat und chaotischem Noisecore an – statt hardcore Hip-Hop scheint die Devise Hardcore mit Hip-Hop zu sein. Den Ohrenschmerz/-schmaus (je nach Standpunkt) von „Giving Bad People Good Ideas“ und „Hot Head“ relativieren die folgenden Songs zwar etwas, aber Bottomless Pit gehört selbst ohne die beiden ersten Knaller noch zum Brutalsten der DG-Diskographie.
Zwei Jahre nach der Ankündigung, Death Grips habe seinen kreativen Höhepunkt erreicht und würde aufhören zu existieren, hauen die größten Spinner nach/vor Kanye West oder die wichtigste Band des Jahrzehnts (ebenfalls vom Standpunkt abhängig) etwas raus, das NO LOVE DEEP WEB von 2012 fast ebenbürtig ist. Wo jenes mit einem Dickpic-Cover gekrönte Album das Konzept des Deep Web in paranoiden Psychohorror verarbeitete, ist die Gewalt von Bottomless Pit physischer und der chaotischen Wucht ihrer Liveauftritte wahrscheinlich am nächsten. In dieser Grube gibt es zwar auch no love, aber wer weichgespült werden will, kann sich ja Ultimate Care II anhören.
Holy Fuck: Congrats
 Transzendenz kann man auf verschiedene Weise erlangen (s.u.). Die vierköpfige Band Holy Fuck tut das durch treibende Beats und schroffe Electronics. Ihr viertes Album heißt Congrats und enthält zum ersten Mal auch Gesang – nicht immer erfolgreich, aber verständlich, ist bei ihrer Musik die Gefahr der Wiederholung schließlich groß. Und auch wenn das neue Album hinter dem erstklassigen Latin zurückbleibt, besitzt es den typischen Holy Fuck Charme.
Transzendenz kann man auf verschiedene Weise erlangen (s.u.). Die vierköpfige Band Holy Fuck tut das durch treibende Beats und schroffe Electronics. Ihr viertes Album heißt Congrats und enthält zum ersten Mal auch Gesang – nicht immer erfolgreich, aber verständlich, ist bei ihrer Musik die Gefahr der Wiederholung schließlich groß. Und auch wenn das neue Album hinter dem erstklassigen Latin zurückbleibt, besitzt es den typischen Holy Fuck Charme.
Im Dance Punk Bereich, in den man die Band einordnen kann, hat jeder seine Rolle zu spielen. Out Hud und !!! sind die Gründerväter, LCD Soundsystem die Popstars, Liars die durchgeknallten Künstler und Holy Fuck eben die Raver. Da ist es erstaunlich, dass viele Songs auf Congrats eher Kopfnicken als Gliedmaßenzucken hervorrufen. Der Opener „Chimes Broken“ kommt den ekstatischen Klassikern wie „Stilettos“ noch am nächsten, „House of Glass“ und „Acidic“ behalten wenigstens die rotzigen Synthesizer bei. „Xed Eyes“ und „Neon Dad“ klingen hingegen mehr wie die Ratatat-meets-Indie Version von Holy Fuck. Trotzdem sind die Songs gut und die Diskografie von Holy Fuck gewinnt mit Congrats etwas notwendige Abwechslung.
James Blake: The Colour In Anything
 Ein Jahr zu spät und dann noch nicht einmal den angekündigten zwanzigminütigen Song oder das Kanye-Feature mitgeliefert? Dafür eine Spielzeit, die die Kapazität einer CD (und vieler Hörer) bis zum Maximum ausreizt? Scheiß drauf! Die Versprechen, die James Blake gebrochen hat, gereichen The Colour In Anything nämlich nur zum Guten. Das dritte Album des melancholischen Dub-Songwriters ist an der Oberfläche weniger aufgeregt als der Vorgänger, im Gegenzug aber emotional viel aufwühlender.
Ein Jahr zu spät und dann noch nicht einmal den angekündigten zwanzigminütigen Song oder das Kanye-Feature mitgeliefert? Dafür eine Spielzeit, die die Kapazität einer CD (und vieler Hörer) bis zum Maximum ausreizt? Scheiß drauf! Die Versprechen, die James Blake gebrochen hat, gereichen The Colour In Anything nämlich nur zum Guten. Das dritte Album des melancholischen Dub-Songwriters ist an der Oberfläche weniger aufgeregt als der Vorgänger, im Gegenzug aber emotional viel aufwühlender.
Die Vorstellung, dass Kanye West auf „Timeless“ seinen Senf dazugegeben hätte, wäre The Life of Pablo nicht gewesen, ruft selbst bei einem Kanye Fan wie mir ungutes Magengrummeln hervor und Erinnerungen an „Take a Fall for Me“ wach. Sicher, die Überlänge ist eine Herausforderung, aber wer sie annimmt, wird so richtig beloht: „Choose Me“ zeigt, dass Blake auch gesanglich zu unerwarteten Ausbrüchen fähig ist; „Two Men Down“ funktioniert sowohl als Ballade als auch als Post-Dubstep-Nostalgikum; „Modern Soul“ ist neben „Radio Silence“ der beste Song, der Klaviersound allein ist schon großartig. The Colour In Anything zwingt einen, seine Hörgewohnheiten wieder nach dem künstlerischen Output zu richten anstatt andersherum. Kopfhörer auf und mal 76 Minuten nur zuhören. Dann sieht man auch wieder Farben.
Kapnorth: Dematerealize
 Für ihr zweites Album haben sich Kapnorth aus Luzern was besonderes ausgedacht. Nach drei Jahren Schreiben, Spielen, Aufnehmen der zehn Songs, die es auf Dematerealize geschafft haben, haben sie sie aus der Hand gegeben. Jeder Song ging an eine Filmcrew oder einen Videokünstler, die damit machen konnten, was sie wollten. Acht Videos gibt es bereits, im Herbst soll dazu noch ein Dokumentarfilm erscheinen.
Für ihr zweites Album haben sich Kapnorth aus Luzern was besonderes ausgedacht. Nach drei Jahren Schreiben, Spielen, Aufnehmen der zehn Songs, die es auf Dematerealize geschafft haben, haben sie sie aus der Hand gegeben. Jeder Song ging an eine Filmcrew oder einen Videokünstler, die damit machen konnten, was sie wollten. Acht Videos gibt es bereits, im Herbst soll dazu noch ein Dokumentarfilm erscheinen.
Der Gravitas der Musik ist das Konzept jedenfalls angemessen. Dematerealize ist ein ernstes Album, ein introvertiertes Stück Art Rock. Viele Songs gehen vom Rhythmus aus, verwandeln sich dann durch ungewöhnliche Harmonien und die ausdrucksstarke Stimme von Elia Lobina in sehr poetische Stücke. Und dass sich das Konzept des Albums um Spiritualität dreht, bedeutet nicht, dass es nicht auch Ausbrüche wie auf „Pixies“ oder dem epischen Opener „Ghostly Love“ geben kann. Mehr als bei anderen Alben lohnt es sich, sich eingehender mit Dematerealize zu beschäftigen und diese Erfahrung der Gefühle in sich aufzunehmen.
Klaus Johann Grobe: Spagat der Liebe
 Die Bässe wippen wieder, während Sevi und Daniel ihre Geschichten aus erster Hand erzählen. Das zweite Klaus Johann Grobe Album Spagat der Liebe treibt den Schlagerfunk des Debüts noch weiter und zeigt, dass die beiden Schweizer eine breitere Palette haben, als zuerst gedacht. Den Rhythmen von „Ein guter Tag“ und „Wo sind“ kann sich keiner entziehen. „Pure Fantasie“, „Heut Abend nur“ und „Gedicht“ laden zum Schwelgen ein, während auf Liedern wie „Rosen des Abschieds“ und „Springen wie damals“ die Synthies das motorische Getriebe übertönen.
Die Bässe wippen wieder, während Sevi und Daniel ihre Geschichten aus erster Hand erzählen. Das zweite Klaus Johann Grobe Album Spagat der Liebe treibt den Schlagerfunk des Debüts noch weiter und zeigt, dass die beiden Schweizer eine breitere Palette haben, als zuerst gedacht. Den Rhythmen von „Ein guter Tag“ und „Wo sind“ kann sich keiner entziehen. „Pure Fantasie“, „Heut Abend nur“ und „Gedicht“ laden zum Schwelgen ein, während auf Liedern wie „Rosen des Abschieds“ und „Springen wie damals“ die Synthies das motorische Getriebe übertönen.
Auf Im Sinne der Zeit war die Orgel noch das bestimmende Merkmal. Hier sind es nun, neben den halb dadaistischen, halb Musikantenstadl-würdigen Texten, die bukolischen Synthesizer, die die matten Rottöne des Covers widerspiegeln. „Und wenn du fragst, wohin ich bin,“ laden Klaus Johann Grobe ein, „so komm doch mit, ich bring dich hin.“ Mit dem VW-Bus durch die Berge, während Spagat der Liebe läuft? Da kriegt Traumurlaub eine neue Bedeutung.
Die komplette Review lest ihr hier.
Ogoya Nengo and the Dodo Women’s Group: On Mande
 Samstag Mittag, Regen hängt in der Luft, und doch wird schon getanzt. Ogoya Nengo war die letzten Wochen auf Europatournee, als Abschluss durften sie und ihre Gruppe auf dem Mannheimer Maifeld Derby spielen. Minimale instrumentale Unterstützung, traditionelle Outfits und unverständliche Texte für ein Festivalpublikum, das gerade erst verkatert aufs Gelände taumelte. Ein „culture crash“, gewiss, aber nach ein paar Minuten setzte dann doch der Effekt ein, den On Mande hervorruft.
Samstag Mittag, Regen hängt in der Luft, und doch wird schon getanzt. Ogoya Nengo war die letzten Wochen auf Europatournee, als Abschluss durften sie und ihre Gruppe auf dem Mannheimer Maifeld Derby spielen. Minimale instrumentale Unterstützung, traditionelle Outfits und unverständliche Texte für ein Festivalpublikum, das gerade erst verkatert aufs Gelände taumelte. Ein „culture crash“, gewiss, aber nach ein paar Minuten setzte dann doch der Effekt ein, den On Mande hervorruft.
Das zweite Album der kenianischen Sängerin, das sie und ihre Dodo Women’s Group mit Sven Kacirek und Stefan Schneider aufgenommen haben, ist oft sehr einfache, aber nichtsdestoweniger überwältigende Folklore Musik. In Ogoya Nengos Heimatdorf ist der Dodogesang ein Mittel der Kommunikation und Bewältigung von alltäglichen Geschehnissen. Für uns als westliches Publikum bleibt ohne Kenntnis der Sprache nur das Soziale tanzbarer Musik. Aber die ist dafür auch sehr gut.
Die komplette Review lest ihr hier.
Oracles: Bedroom Eyes
 Wenn das Post-Hype-Album und das Debütalbum die gleiche Platte sind, kann das schnell in die Hose gehen. Zum Glück für uns haben sich die Mitglieder der Oracles, die ja schon etwas länger unterwegs sind, davon nicht beeindrucken lassen, sind aufs Land gefahren und haben dort ein Dutzend Songs aufgenommen. Bedroom Eyes ist feinste Psychedelik, unabhängig davon, dass das gerade in ist.
Wenn das Post-Hype-Album und das Debütalbum die gleiche Platte sind, kann das schnell in die Hose gehen. Zum Glück für uns haben sich die Mitglieder der Oracles, die ja schon etwas länger unterwegs sind, davon nicht beeindrucken lassen, sind aufs Land gefahren und haben dort ein Dutzend Songs aufgenommen. Bedroom Eyes ist feinste Psychedelik, unabhängig davon, dass das gerade in ist.
Die Lieder auf Bedroom Eyes sind irgendwie zeitlos, zwar mit dem Kopf in den Wolken, aber nicht einfach von den Vorbildern kopiert. Außerdem stilistisch aufgeschlossener als die erste EP und für ein mit solchen Ohrwürmern ausgestattetes Album im Kern erstaunlich ruhig. Kein Wunder, dass das die Band Fenster zu einem wirren Video inspiriert hat, das ihr unten findet. Stanford Torus war eine sehr gute Debüt EP, die allerdings auch die Zukunft dieser Art von Musik hinterfragte. Dank Bedroom Eyes wissen wir, dass die Zukunft auch nur die Gegenwart von morgen ist. In der Gegenwart von heute gehören die Oracles jedenfalls in den deutschen Pop Pantheon.
Die komplette Review lest ihr hier.
Orchestra of Spheres: Brothers and Sisters of the Black Lagoon
 „Cleanse you all / of your infotainment love.“ Wozu brauchen wir Kultur, wenn nicht dazu, uns darin zu erinnern, dass hinter dem, was wir täglich sehen und hören, noch etwas anderes steckt. Die Hinwendung zum immateriellen Wahren, Schönen, Guten, ob man es nun Gott, Liebe oder Kunst nennt, sollte ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein. Das erklärt auch die anhaltende Faszination mit psychedelischer Musik, die ja mehr als sonstige Genres auf ein transzendentes Erlebnis abzielt.
„Cleanse you all / of your infotainment love.“ Wozu brauchen wir Kultur, wenn nicht dazu, uns darin zu erinnern, dass hinter dem, was wir täglich sehen und hören, noch etwas anderes steckt. Die Hinwendung zum immateriellen Wahren, Schönen, Guten, ob man es nun Gott, Liebe oder Kunst nennt, sollte ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein. Das erklärt auch die anhaltende Faszination mit psychedelischer Musik, die ja mehr als sonstige Genres auf ein transzendentes Erlebnis abzielt.
Orchestra of Spheres aus Neuseeland wollen mit ihrem neuen Album Brothers and Sisters of the Black Lagoon einen Kult erschaffen und transzendieren dabei World Music Spielarten aus aller Herren Länder. Das Resultat ist fast „utopisch“, zu keinem Ort gehörend, wie die Musik von den Master Musicians of Bukkake. Die Band springt von Funk zu Kuduro-Rhythmen, von indisch klingender Improvisation zu krautig angehauchtem Math Rock, geeint durch eine Bereitschaft, Dadaistisches mit Groovigem zu verschmelzen.